„Ich kaufe Maschinen mit CE-Kennzeichnung – das muss reichen!“
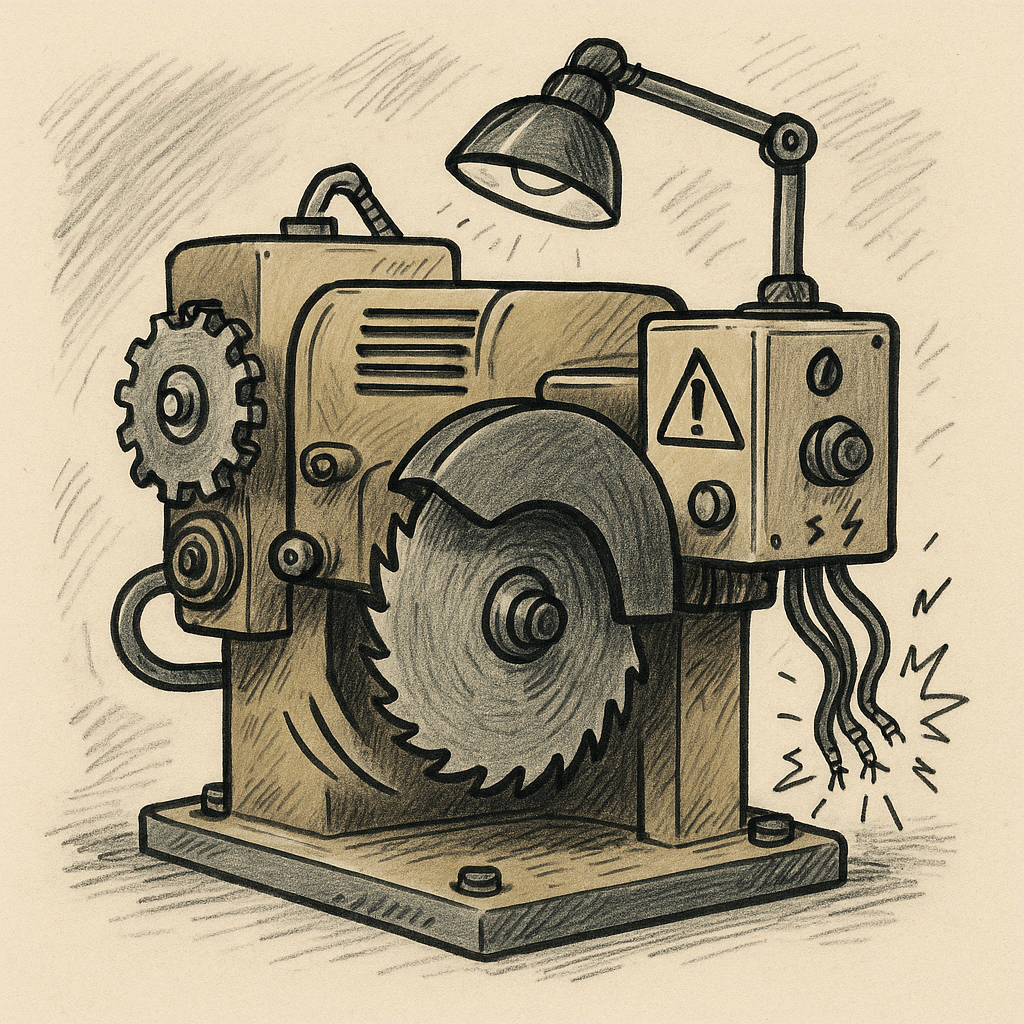
Warum dieser Gedanke gefährlich ist – und was Arbeitgeber wirklich tun müssen
Warum muss der Arbeitgeber den Zustand seiner Maschinen erheben?
Ganz einfach: Weil er gesetzlich dazu verpflichtet ist.
Laut § 33 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) darf der Arbeitgeber nur Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, deren Verwendung sicher ist. Und laut § 4 ASchG muss er alle Gefahren am Arbeitsplatz ermitteln und beurteilen – das gilt ausdrücklich auch für Maschinen, egal ob alt, neu oder mit CE-Kennzeichnung versehen.
Die Verantwortung für den sicheren Zustand der Maschinen liegt immer beim Arbeitgeber – nicht beim Hersteller, nicht beim Händler, und auch nicht beim Mitarbeiter.
Wer glaubt, mit dem Kauf einer CE-gekennzeichneten Maschine sei seine Pflicht erfüllt, irrt sich gewaltig.
Denn:
Die CE-Kennzeichnung sagt nichts über den aktuellen Zustand der Maschine im Betrieb aus.
Der Arbeitgeber muss laufend prüfen, ob Maschinen sicher sind – nicht nur bei der Anschaffung.
Wird der Zustand nicht regelmäßig beurteilt, können schwere Unfälle, Haftungsansprüche und sogar Strafverfahren die Folge sein.
Fazit gleich zu Beginn:
Der Arbeitgeber muss den Zustand seiner Maschinen kennen, weil er dafür haftet.
Das ist kein „Nice-to-have“ – das ist Pflicht.
CE-Kennzeichnung: Was sie bedeutet – und was nicht
Die CE-Kennzeichnung dokumentiert lediglich, dass der Hersteller erklärt, die Maschine erfülle zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung die geltenden EU-Vorgaben. Aber:
Es ist keine Qualitätsprüfung durch eine Behörde
Sie gilt nur im Originalzustand
Sie verpflichtet nicht den Betreiber, sondern dokumentiert die Herstellerverantwortung
Das heißt: Selbst wenn eine Maschine mit CE ausgeliefert wurde, kann sie bereits beim ersten Einschalten im Betrieb unsicher sein – etwa durch:
fehlerhafte Montage
unklare Anleitungen
fehlende Betriebsanpassung
unerkannte Risiken bei der Integration in bestehende Prozesse
Warum Maschinen mit CE-Kennzeichnung trotzdem gefährlich sein können
Umbauten, Nachrüstungen und Eigenlösungen
Maschinen werden oft im Betrieb verändert: neue Werkzeuge, Zusatzfunktionen, andere Steuerungen – ohne sicherheitstechnische Nachbewertung.
→ Die CE-Kennzeichnung verliert womöglich ihre Gültigkeit.Manipulationen durch Mitarbeiter
Schutzhauben werden entfernt, Lichtschranken überbrückt, Not-Aus-Taster verklebt – aus Unwissenheit oder Zeitdruck.
→ Der Arbeitgeber muss solche Risiken erkennen und verhindern.Alter, Abnutzung, fehlende Wartung
Schutzfunktionen versagen, Bauteile verschleißen, Verkabelungen sind beschädigt.
→ CE sagt nichts über den aktuellen Zustand – das ist Aufgabe des Arbeitgebers.Unklare oder fehlende Betriebsanleitungen
Mitarbeiter wissen nicht, wie die Maschine sicher zu bedienen ist.
→ Hier drohen menschliche Fehler mit fatalen Folgen.
Und was ist mit älteren Maschinen ohne CE? – Arbeitsmittelverordnung (AM-VO, § 4 Abs. 4)
Alte Maschinen dürfen verwendet werden – aber nur, wenn sie sicher sind. Das sagt § 4 Abs. 4 AM-VO ganz klar:
„Arbeitsmittel (…) dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen.“
Das heißt:
CE ist nicht erforderlich, wenn die Maschine vor Einführung der CE-Richtlinie (01.01.1995) in Betrieb genommen wurde
Aber: eine sicherheitstechnische Bewertung ist zwingend notwendig
Ggf. sind Nachrüstungen (z. B. Schutzeinrichtungen, Not-Aus, Schutzgitter) zu veranlassen
Wie erkenne ich als Arbeitgeber, ob eine Maschine gefährlich ist?
Hier ein bewährter Praxisleitfaden:
1. Maschinenbestand erfassen
Was steht überhaupt im Betrieb?
Seriennummern, Baujahr, Hersteller, CE vorhanden?
Gab es Umbauten oder Eigenlösungen?
2. Gefährdungsbeurteilung für jede Maschine
Gibt es mechanische, elektrische, thermische, ergonomische Gefahren?
Wie sieht es bei Reinigung, Wartung oder Störung aus?
Sind Schutzvorrichtungen vorhanden und funktionstüchtig?
3. Einbindung von Fachkräften für Arbeitssicherheit (SFK)
Unterstützung bei der Evaluierung gemäß ASchG & AM-VO
Bewertung technischer, organisatorischer und menschlicher Risikofaktoren
4. Maßnahmen setzen
Sicherheitsmängel → beseitigen, nachrüsten, stilllegen
Dokumentieren: Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument (SFK)
Wartungs- und Prüfintervalle festlegen
5. Unterweisung & Sicherheitskultur
Mitarbeiter regelmäßig unterweisen
Manipulationen verhindern – nicht nur technisch, sondern auch durch Haltung
Eine offene Feedbackkultur fördern („Gefährliche Maschine melden = richtig!“)
Schlussfolgerung: CE ist ein Startpunkt – nicht das Ende
Die CE-Kennzeichnung ist eine Herstellererklärung – keine Betriebsgarantie.
Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung für den Zustand und Betrieb der Maschine – zu jedem Zeitpunkt.
Nur durch regelmäßige Prüfung, Evaluierung und Mitdenken aller Beteiligten bleibt eine Maschine sicher.
Nur wer seine Maschinen kennt, kann seine Mitarbeiter schützen.



Bei Fragen würden wir uns freuen Sie bei dem Thema unterstützen zu dürfen. Es gibt auch eine Förderung der Wirtschaftskammer, die Firmen mit Standort in NÖ in Anspruch nehmen können.
Rufen Sie uns an und erkundigen Sie sich. Das Geld liegt auf der Straße, es muss sich nur jemand finden der es aufhebt.



Neueste Kommentare